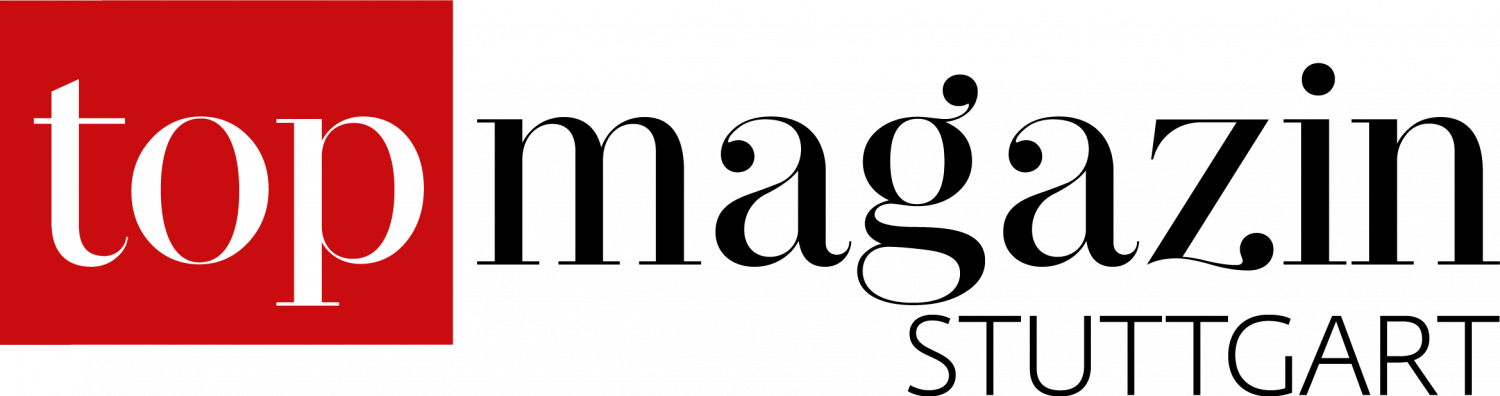Frauenkörper ticken anders

Ein Ehepaar kommt von einer Party nach Hause. „Mensch, der Günther hat sich aber richtig niedergeschlagen angehört“, sagt die Frau. Ihr Gatte hingegen wundert sich über diese Einschätzung. „Niedergeschlagen? Das ist mir gar nicht aufgefallen“, sagt er achselzuckend. Typisch Frau, typisch Mann, oder? Ja, tatsächlich. Dass Frauen anders hören, ist kein Mythos, sondern ein Fakt – und Reinhard Sorgs tägliches Geschäft. Der Hörakustikmeister leitet mit seinem Bruder das Unternehmen „mona & lisa“, die fünfte und neueste Filiale hat Anfang Juli in der Stuttgarter Innenstadt eröffnet. Dort widmet man sich dem weiblichen Gehör.
Reinhard Sorg stellt klar: „Das ist kein Marketinggag.“ Es gebe geschlechtsspezifische Unterschiede beim Hören, allein schon anatomisch, denn bei Frauen sei die Hörschnecke im Innenohr kürzer. Auch funktioniere die Hörverarbeitung anders. Tatsächlich hat eine Studie der Indiana University School of Medicine herausgefunden, dass Männer beim Hören eher die linke Gehirnhälfte nutzen – das Zentrum der Sprachverarbeitung –, während bei Frauen beide Teile aktiv sind. Laut Reinhard Sorg sind dadurch Frauen eher in der Lage, emotionale Beimischungen in Gesagtem zu dekodieren. Zudem habe das weibliche Gehör eine bessere Auflösung für Stimmen oder Sprache. „Frauen hören grundsätzlich besser“, sagt er, die Gründe seien teils unklar. Er berichtet von neuesten Studien, die einen Zusammenhang zwischen dem Hormon Östrogen und dem Hören hergestellt haben sollen.
Allerdings seien Frauen weniger gut in der Lage, die Richtung, aus der der Schall kommt, zu orten. Erklingen Geräusche aus unterschiedlichen Richtungen, ist häufig die Irritation groß, die Frau versteht schlichtweg nicht, was gesagt wurde. Das fällt besonders ins Gewicht, wenn das Gehör ohnehin bereits nachgelassen hat. Nach Reinhard Sorg Erfahrung lässt sich daran mit Trainings arbeiten, außerdem, sofern eine Hörveränderung vorliegt, mit einem Hörgerät. Technik sei allerdings nicht gleich Technik. Frauen seien darauf angewiesen, dass ein Hörsystem Richtungen gut abbilden könne, „das können manche Geräte besser, manche schlechter“.
Das Geschlecht ist in vielerlei Hinsicht relevant. „Auf jeden Fall spielt es eine Rolle“, sagt Dr. Stefan Zieger. Der Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Angiologie führt eine Privatpraxis in Stuttgart-Sillenbuch, und er spricht von vielen kleinen Mosaiksteinen, die die medizinischen Prognosen beeinflussen: Alter, Gewicht, Vorerkrankungen, Lebenswandel, Ernährung, Sozioökonomie, aber eben auch das Geschlecht. Das fange schon beim Hormonhaushalt an. Ist die Patientin in den Wechseljahren, nimmt sie die Antibabypille? Bei Letzterem spricht Stefan Zieger von einem eigenständigen Risikofaktor. „Wenn eine junge Frau mit Atembeschwerden kommt, spielt die Frage nach der Antikonzeption ganz oben rein“, erklärt er. Kein Wunder, denn zu den schwerwiegendsten möglichen Komplikationen bei der Pilleneinnahme gehören Lungenembolien.
Augenscheinlich sind es viele einzelne Dinge, auf die speziell bei Frauen aus medizinischer Sicht geachtet werden muss. Laut dem Arzt spielt etwa das Rauchen bei Patientinnen eine größere Rolle als bei Patienten. Die Risiken, die von dem Laster ausgingen, seien in Summe bei Frauen höher. Wie aus einem SWR-Expertenbeitrag vom Juni dieses Jahres zum Thema „Gendermedizin“ hervorgeht, sind Frauen zudem deutlich häufiger von Autoimmunerkrankungen betroffen als Männer. Den Genen auf dem X- und dem Y-Chromosom wird hierbei eine bedeutende Rolle beigemessen. Frauen starben laut dem Bericht zudem zwar seltener an Covid-19, entwickeln aber doppelt so häufig Spätfolgen. Auch die Symptome von Long-Covid unterscheiden sich demnach.
Das Thema gendersensible Medizin ist noch verhältnismäßig neu, aber es kommt voran. 2007 wurde an der Charité in Berlin das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin gegründet. Die Deutsche Gesellschaft für Genderspezifische Medizin widmet sich ebenfalls biomedizinischer Forschung sowie Präventionsangeboten und Therapiemaßnahmen, die Unterschiede in puncto Geschlechterdimensionen, aber auch weitere Diversitätsfaktoren wie Alter, Herkunft, religiöse Zugehörigkeit, sexuelle Identität, körperliche und psychische Merkmale beleuchten. Mit rund 4,1 Millionen Euro förderte das Bundesgesundheitsministerium 2022 zwölf Projekte innerhalb des Förderschwerpunkts „Genderspezifische Besonderheiten in der Gesundheitsversorgung, Prävention und Gesundheitsförderung“. Auch der Landesgesundheitsminister Manfred Lucha kündigte jüngst in einem dpa-Interview an, sich bald eingehender mit geschlechtsspezifischer Behandlung in der Medizin befassen zu wollen.
Während Medikamente früher eher an Männern erprobt worden seien, und zwar aus Sorge, dass die Frau vielleicht unerkannt schwanger sein könne oder dass sich ihr Hormonzyklus aufs Ergebnis auswirke, gebe es mittlerweile gesetzliche Änderungen, erklärt Carsten Wagner, Apotheker aus Filderstadt. Seither seien zu gleichen Teilen Männer und Frauen als Teilnehmende in Studien vorgeschrieben. Und dies nicht ohne Grund. „Grundsätzlich kann man sagen, dass Medikamente durchaus unterschiedlich wirken“, erläutert er. Bei manchen Schmerzmitteln etwa benötigten Männer höhere Dosen, bei manchen Schlafmitteln wiederum seien Frauen länger müde. Letzteres habe damit zu tun, dass Frauen genetisch bedingt einen höheren Fettanteil im Körper hätten und dadurch manche Wirkstoffe stärker einlagerten. Statistisch betrachtet hätten Frauen zudem mehr Nebenwirkungen. Männern werde eine stärkere Magensäure und eine stärkere Nierenausscheidung zugeschrieben, auch seien sie oftmals schwerer und größer. Allerdings: „Im Einzelfall kann das ganz anders sein“, betont Carsten Wagner. Freilich gibt es große, kleine, alte, junge, pfundige und zierliche Frauen sowie Frauen mit Vorerkrankungen, und Gleiches trifft auf Männer zu.
Die Krankenkassen stellen sich jedenfalls grundsätzlich auf Unterschiede ein. Nadia Mussa, die Leiterin der TK-Landesvertretung in Baden-Württemberg, betont: „Die Berücksichtigung des Geschlechts muss in der Forschung und der medizinischen Versorgung selbstverständlich werden, denn nach wie vor erleben wir in fast allen Bereichen des Gesundheitssystems Qualitätsdefizite durch die fehlende Differenzierung – und zwar für Frauen und Männer.“ Wenn darüber diskutiert werde, wie Daten im Gesundheitswesen besser genutzt werden könnten, gelte es, den Gender-Aspekt mitzudenken, damit keine fehlerhafte Grundlage entstehe. Nur wenn es gelinge, sogenannte Gender-Data-Gaps zu schließen, könnten verfügbare Daten zu einer Verbesserung von Prävention, Diagnose und Therapie für alle beitragen. „Bis es so weit ist, nutzen wir als TK die uns zur Verfügung stehenden Informationswege, um Versicherte sowie Ärztinnen und Ärzte für Gendermedizin, also die geschlechtsspezifische Medizin, zu sensibilisieren“, sagt Nadia Mussa.
Das ist wichtig, denn die klassische Medizinforschung macht keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das führt laut Burkhard Sievers, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Geschlechtsspezifische Medizin, beispielsweise dazu, dass bei Frauen Herzerkrankungen seltener erkannt werden. Tatsächlich zeigen Frauen mitunter andere Symptome, bestätigt der Stuttgarter Mediziner Stefan Zieger. Beispiel Herzprobleme. „Frauen nehmen Angina pectoris anders wahr“, stellt er klar. Während Männer über Schmerzen oder ein Brennen in der Brust klagten, seien Frauen häufig schmerzfrei, litten aber unter Luftnot, mitunter auch an Schweißausbrüchen; ein entscheidender Unterschied, der erst in den vergangenen Jahren in den Fokus gerückt ist. „Die Präventionsmedizin hat in den letzten Jahren gigantische Fortschritte gemacht“, sagt er, gemessen an den Entwicklungen in der Medizin insgesamt sei die Vorsorgemedizin ein Wimpernschlag. Vieles sei bis heute nicht ausreichend erforscht. Für den Hörakustikmeister Reinhard Sorg steht jedenfalls schon lang fest: Frauen werden oftmals benachteiligt. „Hörakustik gibt es für Männer und für Kinder. Für Frauen gibt es das nicht“, sagt er. Auch in der Ernsthaftigkeit der Betrachtung gebe es große Unterschiede. „Dinge für Frauen, das stelle ich regelmäßig fest, werden immer wieder belächelt.“
Müssen sich Frauen nun Sorgen machen? „In der Praxis kämpft man mit ganz anderen Problemen“, stellt der Apotheker Carsten Wagner klar. Deutlich größere Abweichungen bei der Wirkungsweise von Medikamenten verursache etwa die Frage nach der Einnahme. Schluckt jemand eine Tablette vor oder nach dem Essen, gibt es Wechselwirkungen mit anderen Präparaten, und denkt die Person überhaupt regelmäßig dran? „Diese Abweichungen sind viel, viel größer“, sagt er, das Thema Geschlecht spiele da tatsächlich eine untergeordnete Rolle. „Wir haben auch ganz unterschiedliche Enzymsysteme“, fügt Carsten Wagner hinzu, in Zukunft werde also viel entscheidender sein, was für ein Enzymtyp die Person sei und wie sie ein Medikament vertrage.
Auch der Kardiologe Stefan Zieger will das Ganze nicht überdramatisiert wissen. „Wichtig ist, dass wir bei der Arbeit den Geschlechtsaspekt wahrnehmen, aber nicht überbetonen“, sagt er. Dem 63-Jährigen ist daran gelegen, den Menschen als Individuum zu sehen. Mann ist nicht gleich Mann, Frau ist nicht gleich Frau, und der Mensch sei sowieso ein – wie er sich ausdrückt – Gesamtrisikokunstwerk. Zudem stellt er klar: „Spätestens ab der Therapie ist alles gleich.“
Text: Caroline Holowiecki